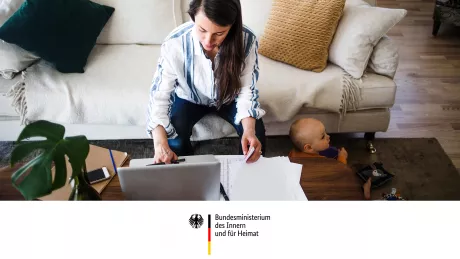Welche Trends könnten die nächsten Jahrzehnte prägen, wo bedarf es neuer Lösungen? Die Expertinnen und Experten der Bundesdruckerei hinterfragen Bestehendes und erkunden Technologien für die Welt von morgen. Dabei nutzen sie die im Konzern breit vertretenen Kompetenzen – von Neurowissenschaften, Quantenmechanik bis hin zu Designstudien.
Außer auf klassischen Themen wie etwa Materialforschung für sichere Identitätsdokumente liegt der Fokus auf digitalen Technologien. Im Vordergrund aktueller Projekte stehen Themen wie mobile Lösungen und biometrische Verfahren, künstliche Intelligenz sowie Quantentechnologien und Postquantum-Kryptografie. Ein zentrales Ziel ist, dem Menschen durch selbstbestimmte Identitäten (SSI) in einer zunehmend virtualisierten Lebenswelt den Überblick und die Kontrolle über sein digitales Ich zu verleihen. Dafür entwickelt die Bundesdruckerei vertrauenswürdige Ökosysteme, deren Elemente sicher ineinandergreifen und Insellösungen überwinden.
Innovation im Netzwerk
Die Forscher und Entwickler der Bundesdruckerei arbeiten hoch vernetzt: Viele Innovationen entstehen in enger Kooperation mit renommierten Forschungsinstituten und Unternehmen. So werden systematisch neue Wissensgebiete erschlossen, Erkenntnisse der Grundlagenforschung in tragfähige Technologien überführt und Entwicklungsprozesse beschleunigt. Mit Stiftungsprofessuren treibt der Konzern den akademischen Austausch und die Nachwuchsförderung voran. Unsere Expertise ist in nationalen und internationalen Standardisierungsgremien gefragt – unter anderem in Arbeitsgruppen von DIN, ISO, ICAO und NIST.
Ausgewählte Kooperationspartner der Bundesdruckerei:
- Stiftungsprofessur an der FU Berlin: Cybersicherheit mit künstlicher Intelligenz
- Hasso-Plattner-Institut: Identitätsmanagement und IT-Sicherheit
- Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC: sichere Hardware und Software, Quantenkryptografie