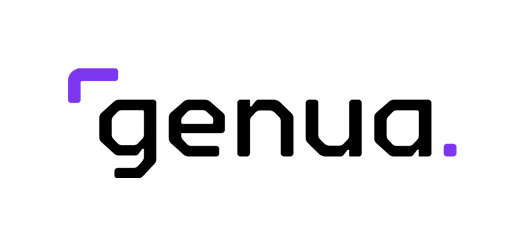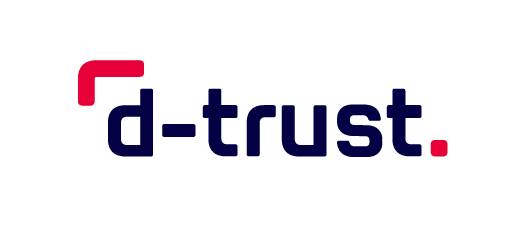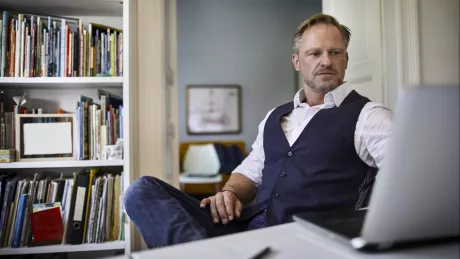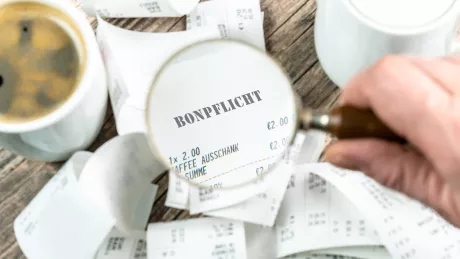Digitale Souveränität: Was ist das?
Worin unterscheiden sich hier die Anbieter- und die Anwenderseite? Was bedeuten Technologie- und Datensouveränität und welche Fähigkeiten braucht man, um digital souverän agieren zu können.
Digitale Souveränität: Bedeutung und Grundlagen
Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit von Staat, Verwaltung und Wirtschaft, Technologien und Daten unabhängig, sicher und rechtskonform zu nutzen. Sie schafft Vertrauen, stärkt die Handlungsfähigkeit und unterstützt die Selbstbestimmung in einer zunehmend vernetzten Welt.
Digitale Souveränität: Definition und Abgrenzung
Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit, digitale Systeme, Prozesse und Daten selbstbestimmt zu gestalten, zu betreiben und zu kontrollieren. Sie ist kein rein technisches Konzept, sondern vereint rechtliche, organisatorische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte der Informationswirtschaft und der Informationswissenschaft. Digitale Souveränität bildet damit den übergeordneten Rahmen, der sicherstellt, dass digitale Infrastrukturen und Dienste auf eigenen Werten, Standards und Rechtsordnungen basieren – nicht auf externen Abhängigkeiten. Sie konkretisiert sich in vier zentralen Säulen – Governance, technische Souveränität, operative Souveränität und Datensouveränität –, die gemeinsam die Grundlage für eine selbstbestimmte digitale Zukunft schaffen. Diese Zukunft stärkt nicht nur staatliche Hoheit, sondern auch Autarkie und Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Raum.
Säulen der digitalen Souveränität
Das „Cloud Sovereignty Framework“ der EU-Kommission definiert acht Souveränitätsziele – die sogenannten „Sovereignty Objectives“ (SOVs), die für die Bereitstellung von Cloud-Diensten in Vergabeverfahren relevant sind. Angelehnt an diese Ziele lassen sich vier Säulen digitaler Souveränität definieren:
Diese Säulen erlauben ein umfassendes Verständnis des Konzepts. Im Fokus stehen europäische Cloud- und Sicherheitsstandards, starke digitale Identitäten und zukunftsfähige Verschlüsselung – auch mit Blick auf die Post-Quanten-Ära.
Warum digitale Souveränität für Staat und Verwaltung zentral ist
Die digitale Leistungsfähigkeit entscheidet zunehmend über staatliche Handlungsfähigkeit. Für öffentliche Verwaltungen gilt: Nur wer digitale Prozesse, Datenströme und Technologien selbst kontrolliert, kann sicher, rechtskonform und unabhängig agieren.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgelegt, dass digitale Souveränität und Informationssicherheit zentrale Voraussetzungen für demokratische Stabilität und ökonomischen Wohlstand sind. Sie verpflichtet sich darin die digitale Souveränität Deutschlands gezielt zu stärken und technologische Abhängigkeiten zu reduzieren.
Diese Leitlinie bildet einen zentralen Bestandteil der Modernisierungsagenda, mit der Staat, Wirtschaft und Gesellschaft widerstandsfähiger und zukunftsfähiger gestaltet werden sollen. Dabei stehen offene Schnittstellen, offene Standards und der konsequente Einsatz von Open-Source-Technologien im Mittelpunkt. Durch eine strategische Ausrichtung des IT-Budgets sollen nachhaltige, interoperable und vertrauenswürdige digitale Infrastrukturen entstehen. Dennoch bestehen weiterhin Abhängigkeiten – vor allem von außereuropäischen Konzernen und Softwareanbietern.
Diese Abhängigkeiten bergen Risiken: von unterbrochenen Lieferketten über Sicherheitslücken bis hin zu unklaren Rechtslagen beim Datenschutz. Mittlerweile hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) seine Entscheidung bekräftigt, sich von außereuropäischen Anbietern unabhängiger zu machen, und plant, künftig die deutsche Softwarelösung openDesk zu nutzen. Das verdeutlicht die Notwendigkeit, vertrauenswürdige europäische Alternativen zu fördern und einzusetzen.
Verantwortung und Zusammenarbeit
Digitale Souveränität ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die die Sicherheit stärkt und die Innovationskraft der Gesellschaft antreibt. Bund, Länder, Kommunen und private Anbieter müssen gemeinsam an sicheren Infrastrukturen und interoperablen Lösungen arbeiten. Gleichzeitig ist es Aufgabe der Politik – insbesondere der Bundesregierung –, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Innovation, Informationssicherheit und Selbstbestimmung gleichermaßen fördern.
Wirtschaft
- Entwickelt und betreibt souveräne Schlüsseltechnologien (Cloud, Kryptografie, Identitäten, Schnittstellen)
- Liefert auditierbare Lösungen mit offenen Standards, SBOMs und klaren Exit-Strategien
- Verpflichtet sich auf europäische Rechtsräume, Transparenz und Sicherheitszertifizierungen
Zivilgesellschaft
- Bildet Vertrauen durch Beteiligung, digitale Kompetenzen und unabhängige Kontrolle
- Bringt Perspektiven zu Datenschutz, Inklusion und Barrierefreiheit ein
- Unterstützt durch Civic-Tech-Initiativen die Entwicklung offener, gemeinwohlorientierter Dienste
Wissenschaft & Standardisierung
- Forscht an zukunftsfähiger Kryptografie (inkl. Post-Quanten-Kryptografie), Interoperabilität und sicheren Architekturen
- Arbeitet in Normungs- und Standardisierungsgremien mit, um europäische Standards praxistauglich zu machen
- Stärkt Wissenstransfer durch Pilotprojekte, Reallabore und unabhängige Evaluationen
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelingt, wenn alle Akteure nach gemeinsamen Prinzipien handeln:
- Offenheit
- Interoperabilität
- Klare Datenlokation
- Möglichkeit zur Reversibilität
- Überprüfbare Nachweise wie Zertifizierungen, Audits oder regelmäßige Sicherheits- und Compliance-Berichte
- Langfristige Pflege der Lösungen
- Kontinuierlicher Wissens- und Kompetenzaufbau
Mit Sicherheit souverän: die Lösungen der Bundesdruckerei-Gruppe
Die Bundesdruckerei-Gruppe leistet mit ihrer Digital- und Sicherheitskompetenz als Technologieunternehmen des Bundes einen Beitrag für die digitale Souveränität Deutschlands und Europas . Ihre Konzerngesellschaften schützen Daten, Infrastrukturen und digitale Prozesse – und schaffen so die Grundlage für eine souveräne und sichere digitale Zukunft:
Exkurs: Post-Quanten-Kryptografie und künftige Sicherheitstechnologien
Mit Blick auf künftige Bedrohungen gewinnt auch die Post-Quanten-Kryptografie an Bedeutung. Quantencomputer könnten langfristig klassische Verschlüsselungsverfahren (z. B. RSA oder ECC) brechen. Schon heute ist es daher wichtig, sich gegen das „Store now, decrypt later“-Prinzip zu wappnen.
Die Bundesdruckerei-Gruppe engagiert sich aktiv in der Forschung zu und Entwicklung von quantenresistenter Kryptografie und ist Gründungsmitglied der Bundesquantenallianz. Mit innovativen Projekten und Technologien arbeitet die Bundesdruckerei daran, die Potenziale von Quanteneffekten für neue Sicherheitslösungen zu schaffen, die auch in einer Welt mit leistungsfähigen Quantencomputern Bestand haben – zum Beispiel im Bereich quantensicherer Ausweisdokumente.
Fazit: digitale Eigenständigkeit ist Zukunftsaufgabe
Digitale Souveränität ist kein Zustand, sondern ein fortlaufender Prozess. In den nächsten Jahren wird die Verwaltung verstärkt auf europäische Cloud-Plattformen, Quantensicherheit und KI-gestützte Sicherheitssysteme setzen. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, die digitale Hoheit Deutschlands zu stärken und damit den technologischen Wohlstand langfristig zu sichern.
Vollständige Unabhängigkeit ist dabei weder realistisch noch wünschenswert. Digitale Souveränität bedeutet nicht Abschottung, sondern bewusste Kontrolle über kritische Technologien und Daten. Entscheidend ist die richtige Balance: Offenheit und Vernetzung, wo sie Innovation und Effizienz fördern, und gezielte Eigenständigkeit dort, wo Informationssicherheit und staatliche Handlungsfähigkeit auf dem Spiel stehen.
Häufige Fragen zur digitalen Souveränität
Digitale Souveränität schützt staatliche Handlungsfähigkeit und Datenschutz, stärkt IT-Sicherheit und reduziert Abhängigkeiten. Nur wenn digitale Infrastrukturen vertrauenswürdig und nachvollziehbar betrieben werden, bleibt die Verwaltung langfristig leistungsfähig.
Durch klare Datenklassifizierung, verschlüsselte Speicherung und transparente Zugriffsregeln. Ergänzend sichern europäische Cloud-Lösungen und nationale Rechenzentren die Kontrolle über Speicherort und Rechtsrahmen.
Sie fördern Interoperabilität und Transparenz – zentrale Voraussetzungen, um souveräne digitale Ökosysteme zu schaffen. Offene Standards ermöglichen es, Systeme zu wechseln, ohne in Abhängigkeiten zu geraten.
Digitale Souveränität und Cybersicherheit bedingen sich gegenseitig. Nur mit einer robusten Cybersicherheit lassen sich Daten, Infrastrukturen und staatliche wie organisatorische Interessen wirksam schützen. Gleichzeitig bildet digitale Souveränität den strategischen Rahmen, der eine verlässliche Cybersicherheit ermöglicht und die digitale Selbstbestimmung langfristig sichert.